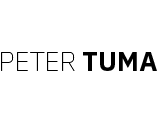Zu Peter Tumas Kopf-Bildern
Rolf Bier, 1993
Die Anthropologie könnte noch mehr, als es bislang passiert, Kunstwerke für ihre Forschungen fruchtbar machen, wenn man diese als Zeugnisse einer sich ändernden Wahrnehmung lesen würde: Es scheint zumindest auffällig, dass der menschliche Kopf durch die Jahrhunderte hindurch immer stärker in den Mittelpunkt des Interesses, der Suche des Menschen nach sich selbst, gerückt ist. Wer heutzutage bestritte, dass der Kopf Sitz des intelligiblen Wesens Mensch sei, machte sich lächerlich. Andere Zeiten, andere Religionen und Philosophien als die christlich-europäische, haben das anders gesehen oder sehen es bis heute anders. Fernab von der Frage, ob der Kopf das Zentrum des Menschen ist oder nicht, hat er aber unbestritten zentrale Aufgaben: Er ist als Schädel nicht nur Trägergerüst für das Gehirn, also Ort des Denkens, sondern auch eine der großen Bühnen des psychologischen Ausdrucks. Im Gesicht spricht sich mehr aus, als der Mensch es von sich selbst wissen kann. Im Zusammenspiel von Augen und Mund zeigt sich der Mensch, vor allem dann, wenn das Denken zurücktritt, das Sprechen aufhört und die Instinkte und Affekte gefordert sind. Man mag es als Fluch oder Segen sehen: Das Denken entwickelt sich ungesehen und kann sich verbergen. Das Organ seiner Vermittlung liegt letztlich außerhalb des Körpers, und dieses – die Sprache – lebt nicht, wenn es nicht benutzt wird. Nichts anderes meint das Wort von den Gedanken, die frei sind: Als lautlose, verschwiegene bleiben sie zwar ungehört, aber ihre soziale Kraft entscheidet, ob sie kalkuliert verschwiegen werden (müssen). Das Fühlen aber - man könnte es auch als die direkte, aber sprachlose Seite des Denkens begreifen - entäußert sich paradoxerweise immer, eswird sichtbar als Körpersprache. So ist im Phänomen des Kopfes und in unserem Nachdenken darüber eine verwirrende Ambivalenz von einem lnnen und Außen festgeschrieben, die die Künstler und Wissenschaftler bis heute immer wieder zu Untersuchungen gereizt hat mit dem Ziel, als Einheit verstehen zu können, was sich physiologisch und im kommunikativen System trennt. Dabei haben im Laufe der Zeit physiognomische Lehren zu Recht ausgedient und individuaIpsychologischen AnsätzenPlatz gemacht. Das Geheimnis des Menschen liegt ab hier darin, nicht mehr Typus zu sein, sondern über eine Persönlichkeit zu verfügen, so rätselhaft sie einem selbst bislang auch erscheinen mag.
Die Porträtisten unter den Künstlern haben diesen Persönlichkeiten nachgespürt und so versucht, das Unmögliche zu malen. Das Drama des modernen Menschen ist wohl die Entdeckung dieses Widerspruches von Außen und Innen an sich selbst und der damit verbundene gänzliche Verlust positiver Naivität, selbst noch an das glauben zu können, was man sieht, wenn man schon dem nicht mehr traut, was man hört. Wahrheit kann keinen objektiven Sachverhalt mehr meinen und kann als subjektive Wahrheit auch spekulativ inszeniert werden. Wirklich bemüht um Wahrheit ist aber nur der, der versucht, jene strukturelle lnterferenz des Innen und Außen kommunikativ offenzulegen. Im Wechsel vom phänomenologischen zum psychologischen Weltbild verändert sich zwangsläufig die Sichtweise der Künstler: Die Systeme der Typisierungen treten zurück, die Künstler individualisieren nicht nur die Gegenstände, sondern auch die Art der Darstellung. Es ist also – da dieser Prozess bis heute anhält – weder originell oder verwunderlich, dass sich viele moderne Künstler immer wieder mit dem äußerst komplexen Kopfthema auseinandersetzen. In einer Welt voller scheinbar individueller Porträts liegt die Relevanz ihrer Arbeit aber gerade darin, das Authentizitätsversprechen des Mediums – i.ü. auch das der Fotografie – zu problematisieren. An der Innen-Außen-Struktur des Kopfes findet dieses Anliegen sein geradezu ideales Motiv.
Peter Tuma ist andere Wege gegangen und hat vor drei Jahren eine bislang nicht abgeschlossene Werkserie von Kopfzeichnungen begonnen. Es interessiert an dieser Stelle ausschließlich, wie ein sich als gegenständlicher Zeichner verstehender Künstler heutzutage dem Kopfmotiv begegnet. Die Basis von Tumas Arbeit ist das gewachsene Interesse des Künstlers am Fragment, das in anderen Werkserien, zum Beispiel der der Flügel und neuerdings auch der der Herzenvorformuliert ist. Dabei meinte Tuma nicht die künstlerische Form des Fragments, sondern das tatsächliche, von einer großen Einheit abgetrennte, isolierte Detail, das auf wundersame Weise ein Eigenleben gewinnt. Tumas Beschäftigung mit fragmentierten Körperteilen und Organen erfolgt in der Hoffnung, dass sich im Unvollständigen klarer über Zusammenhänge reden lässt. In der Unverbundenheit des Fragments wird das Fehlende bewusst, aber ohne sich zu benennen. Während das Fragment sich versinnbildlichen muss, setzt die Restaurierung der Zusammenhänge an der Nahtstelle der Trennung im Kopf des Betrachters ein. Je umfassender das Fragment mit den zeichnerischen Mitteln in eine neue, ästhetische Einheit gebracht wird, desto eindringlicher fragt es nach dem Organismus, dem es entstammt. Das führt sogar soweit, dass logische Strukturen verdreht, umgekehrt werden: Das Fragment erscheint (im Bild) als Einheit, der gedachte Zusammenhang als fragmentiert.
So arbeitet die Struktur des Fragments in den Kopfzeichnungen Tumas ganz im Sinne des Satzes, dass das, was wir sehen, nicht das ist, was wir sehen. Trotz abstrahierender Übersetzung erkennen wir mit Gewissheit die abgetrennten, abgeschlagenen Köpfe auf den Zeichnungen. Ikonologisch schließt das Motiv an den Mythos von Judith und Holofernes an, das in biblischen Darstellungen als Johannes-Schüssel wiederkehrt. Tuma vermeidet in seinen Kopfzeichnungen nun gegen alle kunstgeschichtlichen Darstellungen das Drastische und Anekdotische. Die Köpfe sind in geometrisierenden Ovalformen fast ohne Halsansatz in einen engen, zugleich diffusen Bildraum gespannt. Die Zeichnung organisiert sich selbst, naturalisiert das dramatische Fragment im handschriftlichen Gefüge von Linie und Fläche. Die Köpfe sind stets von hinten gesehen, sie wenden sich vom Betrachter ab, verbergen demonstrativ jegliche Individualität, bannen jede psychologische Spannung der Brutalität oder der Rache. Die Köpfe werden in einem hermetischen, ungeschichtlichen Raum zu eigentümlichen Universalzeichen.In dem weiten Abstand zu allem, was wir gewohntermaßen mit Kopf verbinden, liegt das Besondere von Peter Tumas Zeichnungen. Sie tragen auf ihre Weise und mit ihren Mitteln der eigenartigen Erkenntnis Rechnung, dass das psychologische Moment der Innen-Außen-Spannung im physiognomischen Illusionismus eben nicht zu fassen ist. Tuma verlagert es in die Psychologie des Fragments und dessen Wahrnehmung: Nur der Betrachter rehabilitiert die anonymen Kopfzeichnungen als offensive Fragen nach dem menschlichen status quo.
Rolf Bier, Zu Peter Tumas Kopf-Bildern, in: Michael Schwarz, Peter Tuma. Mit einem Beitrag von Rolf Bier, (Kunst der Gegenwart aus Niedersachsen Bd. 41), Verlag Th. Schäfer, Hannover 1993, S. 64 – 66.